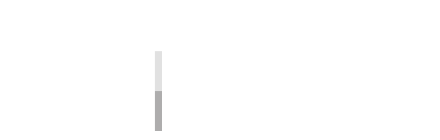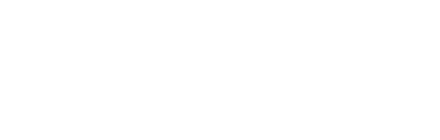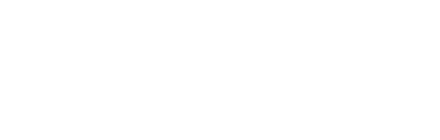Entwicklungsarbeit für die Strahlentherapie
Die Forscher rund um Prof. Dr. Wolfgang Enghardt leisten Tag für Tag Entwicklungsarbeit, um die Strahlentherapie von Tumoren mit Protonen- und Ionenstrahlen noch präziser zu machen.
Innerhalb der Sektion sind Nachwuchsforschergruppen organisiert, die sich um spezielle Forschungsanliegen bemühen. Dr. Guntram Pausch arbeitet mit seinen Kollegen an der Thematik In-vivo Dosimetrie für neue Strahlenarten. Gemeinsam entwickeln die Forscher den Prototypen eines Kamerasystems, das zukünftig für den klinischen Einsatz vorgesehen ist. Ziel ist es, die Dosis an Protonen- und Ionenstrahlen während der Tumorbehandlung genau zu überwachen. Weltweit werden Methoden erforscht, die es ermöglichen könnten, die Reichweite der Protonen im Gewebe nicht nur präzise vorauszusagen, sondern direkt im Körper zu messen. Eine solche Reichweitekontrolle in Echtzeit, also während der Behandlung, mit ausreichender Präzision durchzuführen ist Ziel der Forschungsgruppe. Damit könnten die bisher noch notwendigen Sicherheitssäume am Rande des Tumors verringert werden. Das würde die Behandlungen noch schonender machen. Der Forschungsgruppe ist es im vergangenen Jahr gelungen, eine neue, überraschend einfache Technik zur Reichweitekontrolle theoretisch zu begründen und experimentell zu verifizieren. Diese beruht auf einem Effekt, der bislang kaum beachtet und höchstens als Fehlerquelle betrachtet wurde: Protonen benötigen eine sehr kurze aber endliche Zeit, bis sie das Zielgebiet im Körper erreichen und dort zur Ruhe kommen. Die Abbremszeit hängt vom Bremsweg – der Reichweite – ab. Gammastrahlung, die auf diesem Weg erzeugt wird, entsteht deshalb innerhalb eines wohlbestimmten Zeitfensters, dessen Breite mit wachsender Reichweite zunimmt. Zeitverteilungen dieser prompten Gammastrahlung kann man mit geeigneten Detektoren leicht aufnehmen. Ein Vergleich der gemessenen mit den anhand des Behandlungsplans modellierten Zeitspektren lässt erkennen, ob die applizierte Dosisverteilung der Planung entspricht und gestattet im Falle grober Abweichungen einen Abbruch der Bestrahlung schon nach wenigen Sekunden. Im Gegensatz zu anderen international verfolgten Konzepten beruht das Prompt Gamma-Ray Timing (PGT) genannte Verfahren allein auf einer Zeitmessung, die gegebenenfalls mit einem einzigen handelsüblichen Detektor durchgeführt werden kann, und nicht auf dem ortsaufgelösten Nachweis einzelner oder mehrerer (koinzidenter) Gammaquanten mit Hilfe komplexer Detektorsysteme.
Ebenfalls Teil der Sektion Strahlenphysik ist das Verbundprojekt onCOOPtics – Hochintensitätslaser für die Radioonkologie. In ihm kommt die Expertise beider Zentren für Innovationskompetenz (ZIK) „ultra optics“ Jena und „OncoRay“ Dresden und des Helmholtz-Zentrum Dresden- Rossendorf zusammen. Die Arbeitsgruppe um Dr. Jörg Pawelke entwickelt laserbasierte Strahlentherapiegeräte für die präzise therapeutische Behandlung von Krebserkrankungen mit Protonen- und Ionenstrahlen. Unter anderem beschäftigen sich die Wissenschaftler mit der Erhöhung der Protonenenergie, für den Einsatz im klinischen Alltag. Um das erforderliche hohe Strahlenniveau zu erreichen, muss die Hochleistungsinfrastruktur im HZDR weiter ausgebaut werden. Hier wurde der Ultrakurzpulslaser DRACO in einer neuen Experimentierumgebung installiert, wo seine Kapazität erweitert werden konnte. Parallel wird der diodengepumpte Petawattlaser Penelope weiter entwickelt. Ziel ist es, ihn im therapeutischen Betrieb bei Patienten anwenden zu können. Dazu werden Zellen von Tieren bestrahlt und die Strahlführung in der Gantry weiter entwickelt. Diese muss rotieren, um die gewünschten Erfolge zu erzielen.
Ebenfalls Teil der Sektion Strahlenphysik ist die Forschergruppe Hochpräzisionsstrahlentherapie. Ihr Anliegen sind medizinphysikalische Beiträge zur Translationsforschung in der Protonenbestrahlung. Generelles Ziel ist zum einen die Ausarbeitung und klinische Implementierung von robusten und präzisen Bestrahlungsmethoden speziell für die Partikeltherapie. Dabei steht die Anpassung der Dosisapplikation an sich verändernde anatomische Situationen, ausgelöst durch Tumorbewegung oder die Reaktion auf die Strahlentherapie, im Fokus. Zum anderen ist die Integration umfassender Bildinformation, zum Beispiel aus der Dual Energy Computertomografie oder der funktionalen Bildgebung, in die Therapieentscheidung und Bestrahlungsplanung Gegenstand der Arbeit der aus Physikern und Medizinern bestehenden Nachwuchsforschergruppe. Hierfür erarbeiten die Forscher um Dr. Christian Richter medizinischphysikalische Kriterien für die Partikelbestrahlung. Damit leisten die Wissenschaftler einen wesentlichen Beitrag zur Bewertung von medizinischen und ökonomischen Aspekten der Strahlentherapie.
Die gesamte Forschungsarbeit innerhalb der Sektion Strahlenphysik erfolgt in enger Kooperation mit Forschungsgruppen des HZDR: Das Institut für Strahlenphysik der Professoren Thomas Cowan und Ulrich Schramm beschäftigt sich mit Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Beschleuniger-, Kern-, Hadronen- und Laserphysik. Darüber hinaus arbeiten die Forscher an der Entwicklung neuer Arten von Strahlung und Teilchenstrahlen, neuer Detektoren und Messmethoden. Die Verfahren werden in der der Krebsforschung, in der Nuklearen Sicherheitsforschung und auf dem Gebiet der neuen Materialien angewendet. Am Institut für Strahlenphysik arbeitet die Abteilung Laser-Teilchenbeschleunigung von Prof. Ulrich Schramm. Ihr Kernthema ist die experimentelle und theoretische Untersuchung der Licht- Materie-Wechselwirkung im relativistischen Intensitätsregime. Dabei steht die Entwicklung neuartiger kompakter und brillanter Quellen relativistischer Teilchenstrahlen und die Untersuchung auf ihre Anwendbarkeit beispielsweise im Bereich der Strahlenmedizin im Mittelpunkt.