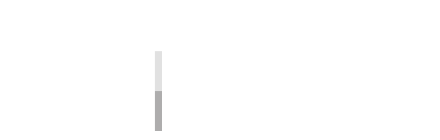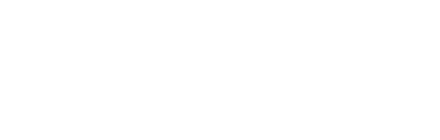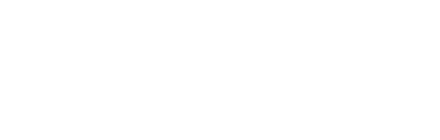Krebsforschung am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Von verbesserten Diagnosemöglichkeiten bis hin zur wirksamen Therapie – das ist der Fokus der Institute für Radioonkologie – OncoRay sowie für Radiopharmazeutische Krebsforschung am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Die physikalischen Arbeiten am Institut für Strahlenphysik zielen auf einen kompakten Teilchenbeschleuniger für die Protonentherapie ab. Das Zentrum beschäftigt rund 450 Wissenschaftler (gesamt: 1.100 Mitarbeiter), die in unterschiedlichen Forschungsprojekten auf den Gebieten Gesundheit, Energie und Materie tätig sind.
Um Fortschritte im Kampf gegen Krebs zu erzielen, sind fachübergreifende Anstrengungen nötig. Dazu hat sich das HZDR mit dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden im OncoRay-Zentrum zusammengeschlossen. Alle Mitarbeiter des Instituts für Radioonkologie –OncoRay arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen am OncoRay. Die Gruppe „In-vivo Dosimetrie für neue Strahlenarten“ besteht durchgehend aus HZDR-Wissenschaftlern und die Gruppenleiter Prof. Anna Dubrovska und Dr. Christian Richter sind ebenfalls Mitarbeiter des HZDR.
Mit Laserlicht Teilchen auf Trab bringen
Eine wirkungsvolle Methode der Krebsbehandlung ist die Protonentherapie. An der Universitäts Protonen Therapie Dresden (UPTD) werden seit Ende 2014 Patienten behandelt. Betreiber ist ein Konsortium aus Universitätsklinikum, Medizinischer Fakultät der TU Dresden sowie dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.
Um die Protonen zu erzeugen, sind bisher große Beschleunigeranlagen nötig. Deshalb arbeiten HZDR-Forscher daran, Teilchen mithilfe von intensivem Laserlicht zu beschleunigen. Auch hier kommt die Stärke des OncoRay-Zentrums zum Tragen. Während die Physiker am HZDR diese Entwicklung technisch vorantreiben, geben die Mediziner des Uniklinikums vor, wie der vom Laser erzeugte Teilchenstrahl beschaffen sein muss, um die gewünschte Wirkung im menschlichen Körper zu erzielen.
Und Medizinphysiker und Physiker hier wie dort arbeiten daran, die Eindringtiefe der konventionell oder per Laser beschleunigten Protonen exakt zu berechnen und mit neuartigen Verfahren noch während der Therapie genau zu messen.
Radioaktivität in Diagnostik und Therapie
Für die Krebsdiagnostik entwickelt das HZDR-Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung radioaktive Sonden und Software-Algorithmen für die moderne Bildgebung mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Radioaktive Medikamente könnten in Zukunft auch bei der Therapie zum Einsatz kommen, um Tumorgewebe direkt im Körperinneren zu bestrahlen (Endoradionuklid-Therapie). Neuartige Immuntherapeutika zusätzlich mit radioaktiven Strahlern auszustatten, daran wird ebenfalls am HZDR gearbeitet.
Weitere Forschungskooperationen
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) baut zusammen mit dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und dem HZDR seit 2015 den Dresdner Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) auf. Die drei Dresdner Einrichtungen arbeiten zudem innerhalb des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung mit universitären Partnern und dem DKFZ zusammen.